- Softcover : 84 Seiten
- Verlag: Severus Verlag
- Autor: Björn Bedey
- Auflage: 1. Aufl., erschienen am 07.09.2020
- Sprache: Deutsch
- ISBN-10: 3-96345-242-0
- ISBN-13: 978-3-96345-242-0
- Größe und/oder Gewicht: 19,0 x 12,0 cm
„Graf Zeppelin“ Eine Reise um die Welt im Luftschiff
24,00 €
Von dem Testflug des »LZ (Luftschiff Zeppelin) 1« am 2. Juli 1900, der nach 18 Minuten mit einer Wassernotlandung im Bodensee endete, über die erste (und bisher einzige) Weltumrundung im »LZ 127« im Jahr 1929 bis zur »Hindenburg«-Katastrophe im Jahr 1937 die Geschichte der fliegenden Zigarren präsentiert sich in einer außergewöhnlich vielseitigen Reise! Ganz am Anfang davon steht der namensgebende Ferdinand Adolf Heinrich August Graf von Zeppelin (18381917). Dieser Mann gilt als der Begründer des Starrluftschiffbaus. Trotzdem sollte man nicht unbeachtet lassen, dass bereits vor ihm der Ungar David Schwarz (18501897) in den 1880er Jahren das allererste starre Metallluftschiff erschaffen hatte und für den frühesten Aufstieg eines Starrluftschiffes am 3. November 1897 in Tempelhof bei Berlin verantwortlich war, während der Graf damals nur unter den Zuschauern weilte. Nach dem frühzeitigen Tod des Ungarn übernahm er wiederum dessen Pläne, kaufte seine Patente und entwickelte diese weiter. Seinen langjährigen Traum von einem lenkbaren Luftschiff hatte der Graf laut einer Aufzeichnung in seinem Tagebuch nun schon im April 1874 ins Auge gefasst. Um diesen in die Realität umzusetzen, richtete er 1898 die »Aktiengesellschaft zur Förderung der Luftschifffahrt« ein und steuerte über die Hälfte des damaligen Startkapitals von 800.000 Goldmark (inflationsbedingt in heutiger Währung ca. 5.638.000 Euro) bei. Das Problem der Finanzierung blieb, nebenbei bemerkt, eine immerwährende Konstante in der Zeppelin-Geschichte. Sein eigenes Reichspatent Nummer 98580 für einen »Lenkbaren Luftfahrzug mit mehreren hintereinander angeordneten Tragkörpern« konnte der Graf am 13. August 1898 sichern. Ein Jahr später war endlich alles bereit, sodass der Bau des ersten Zeppelin-Prototyps, des »LZ 1«, in die Wege geleitet werden konnte. Das Ziel des Grafen für seine Schöpfungen war es indes, sie für kommerzielle Zwecke und/oder an das Militär weiter zu verkaufen. Mit dem missglückten ersten Test des »LZ 1« setzte dieser zwar einen neuen Geschwindigkeitsrekord von 9 m/s (32,4 km/h) gegenüber dem französischen Elektroluftschiff »La France« auf, konnte potenzielle Investoren aber noch nicht genügend beeindrucken. Erst durch weitere Spenden und eine speziell entwickelte Lotterie wurde das Geld für die Produktion von weiteren Zeppelinen aufgetrieben. Der Zeppelin, der dann erste tatsächliche Resultate zu verzeichnen hatte und vom Heer erworben wurde, war der »LZ 3«, der sich 1906 das erste Mal in die Lüfte erhob und bis 1908 4.398 Kilometer in 45 Fahrten bewältigte. Das Unternehmen war trotzdem noch nicht finanziell gesichert. Als jedoch der »LZ 4« am 5. August 1908 bei Echterdingen zerstört wurde, konnte erfolgreich zu einer Nationalspende aufgerufen werden, mit deren Hilfe neue Zeppeline gebaut wurden. Die »Zeppelinspende des deutschen Volkes«, oder auch das »Wunder von Echterdingen« genannt, im Umfang von über sechs Millionen Mark (heutiger Wert ca. 36 Millionen Euro), ermöglichte darüber hinaus die Gründung der »Luftschiffbau Zeppelin GmbH« und der »Zeppelin-Stiftung«, deren Vorstand der Ingenieur und Architekt Alfred Colsman (18731955) einnahm. So ist es nicht verwunderlich, dass der Graf von Zeppelin diesen Tag trotz des Unfalls später einmal als »die Geburtsstunde der nationalen Luftschifffahrt in Deutschland« bezeichnen sollte. Das Zeitalter der Passagierflüge eröffnete schließlich der »LZ 6«, der neben weiteren Zeppelinen von der durch Alfred Colsman 1909 ins Leben gerufenen »Deutschen Luftschifffahrts-Aktiengesellschaft« (»DELAG«), der ersten Fluggesellschaft der Welt, erstanden und in den Dienst der zivilen Luftfahrt genommen wurde. Schon bald darauf konnte ein Luftlinienverkehr zwischen mehreren deutschen Städten, darunter Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Dresden und Leipzig, eingerichtet werden. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Jahr 1914 wurden zusammengenommen 25 Zeppeline fertiggestellt und 1.588 Flüge mit 34.028 Gästen ausgeführt. Doch es sollte nicht bei den zivilen Fahrten bleiben. Denn neben dem Grafen von Zeppelin selbst erkannte auch das Militär des Deutschen Reiches das Potenzial der Luftschiffe für den Ausbau der Kriegsführung, weshalb es alle existierenden Zeppeline in Besitz nahm und diese für Aufklärungsflüge und Luftangriffe mit Bomben auf z.B. London, Edinburgh und Antwerpen verwendete. Der einzige Vorteil daran war, dass dadurch etwa 100 weitere Zeppeline hervorgebracht wurden, die im Hinblick auf Größe, Schnelligkeit, Nutzlast etc. immer weiter verbessert wurden. Dieser Aufschwung der Zeppeline erfuhr aber bald einen Dämpfer. Nach der Niederlage Deutschlands forderten die Alliierten im Artikel 202 des Versailler Friedensvertrages als Reparationsleistung eine vollständige Entwaffnung und Auslieferung der Luftschiffe, Luftschiffhallen und Traggasfabriken. Erst 1926 wurden diese Verbote aufgehoben. Der Graf Zeppelin war inzwischen verstorben und Hugo Eckener (18681954) hatte die Leitung übernommen. Sein Ziel für den Weitergang des Zeppelin-Unternehmens war es, dieses von nun an den Passagierfahrten zu widmen. Zu diesem Zwecke erarbeitete er den Plan einer Weltumrundung in einem Zeppelin, um das Können der Giganten im weltweiten Luftverkehr zu demonstrieren. Dafür initiierte er die sogenannte »Zeppelin-Eckener-Spende«, durch die abermals mithilfe des deutschen Volkes ein neues Flugschiff geschaffen werden sollte. Entworfen wurde dieses von Ludwig Dürr (18781956), dem bekannten Luftschiff-Konstrukteur und Technischen Direktor der »Luftschiff Zeppelin GmbH«, der für alle Zeppeline vom »LZ 2« bis zum »LZ 131« zuständig war, und angefertigt wurde es in Friedrichshafen von der »Luftschiffwerft Luftschiffbau Zeppelin GmbH«. Das Luftschiff erhielt das offizielle Luftfahrzeugkennzeichen »D-LZ127« und wurde am 8. Juli 1928 anlässlich des 90. Geburtstags des 1917 verstorbenen Grafen von Zeppelin getauft. Seine Tochter Helene (Hella) Gräfin von Brandenstein-Zeppelin (18791967) benannte es nach ihm: »Graf Zeppelin«. Von der Jungfernfahrt, die am 18. September 1928 stattfand, war es bis zum 19. Juli 1937 im Einsatz. Der »Graf Zeppelin« war allen bisherigen Zeppelinen überlegen. Er war 236,6 Meter lang, hatte einen Durchmesser von 30,5 Metern, ein Traggasvolumen von 105.000 Kubikmetern und bot Platz für 40 Besatzungsmitglieder und 20 Passagiere. Das Flugschiff konnte eine Geschwindigkeit von durchschnittlich 115 und maximal 128 Kilometer pro Stunde erreichen. Es hatte vier Maybach-Motoren und einen fünften Reserve-Motor mit einer Leistung von 410 kW, welche entweder mit Benzin oder Blaugas angetrieben werden konnten. Für den Fall eines Verzichts auf Benzin befanden sich 12 Gasflaschen an Bord. Damit konnte der »Graf Zeppelin« circa 100 Stunden lang fliegen, mit dem Tank 67 Stunden, mit Benzin und Blaugas zusammen 118 Stunden. Für eine Flugstrecke von 10.000 Kilometern war es zusätzlich möglich, den Zeppelin mit 15.000 Kilogramm zu beladen. Mit knapp 1,7 Millionen Kilometern bei 590 unfallfreien Fahrten und 17.177 Flugstunden war der »Graf Zeppelin« das erste Flugschiff mit dieser Flugstreckenlänge und das berühmteste und erfolgreichste Verkehrsluftschiff der Welt. Es überquerte zudem 144 Mal den Ozean, d.h. 143 Mal den Atlantik und einmal den Pazifik. Dabei wurden 34.000 Passagiere befördert, 13.110 davon als zahlende Gäste, und 78.661 Kilogramm an Fracht transportiert. Seit September 1928 wurde der »LZ 127« dank Hugo Eckener unter der »DELAG« und von 1930 an für den transatlantischen Liniendienst zwischen Europa und Nord- und Südamerika eingesetzt. Der »Graf Zeppelin« unternahm mehrere Aufsehen erregende Flüge, zum Beispiel die erste interkontinentale Fahrt von Friedrichshafen nach Lakehurst (südwestlich von New York City) am 11. Oktober 1928, welche infolge eines heftigen Sturmes beinahe in einem Desaster endete, die Palästina-Rundfahrt im April 1931, bei der u.a. die Pyramiden von Gizeh und die Cheopspyramide überflogen wurden, und eine Forschungsreise in die Arktis im Juli 1931. Die größte Sensation erfolgte aber wohl mit der Weltfahrt. Diese ist in die amerikanische Weltfahrt (von Lakehurst bis Lakehurst) und die deutsche Weltfahrt (Friedrichshafen bis Friedrichshafen) untergliedert. Zum Teil wurde sie vom US-amerikanischen Medienmogul William Randolph Hearst (18631951) finanziert. Der Kommandant des »Graf Zeppelin« war Hugo Eckener (18681954) und sein Sohn Knut der Steuermann. Für den Flug waren drei Kapitäne eingeteilt; Ernst August Lehmann (18861937), Hans Curt Flemming (18861935) und Hans von Schiller (18911976). Zu den Passagieren während verschiedener Abschnitte der Weltfahrt gehörten u.a. der australische Polarforscher Sir George Hubert Wilkins, ein Arzt vom spanischen Hofe, Dr. Megías, Journalisten vom Verlag »Ullstein«, Verlag »Scherl«, von der »Frankfurter Zeitung«, der »Matin«, »Das Illustrierte Blatt« und einigen japanischen Zeitschriften, ein Meteorologe namens Dr. Seilkopf von der Deutschen Seewarte in Hamburg sowie streckenweise Vertreter der russischen und japanischen Regierung. Im Auftrag von William Hearst war im Übrigen die einzige Frau, Lady Grace Hay Drummond-Hay, die ein kleines schwarzes Kätzchen mit in den Zeppelin brachte, als Korrespondentin dabei. Von zahlenden Passagieren, die einen Fahrpreis von 10.000 Mark (ca. 3000 Euro) aufbringen mussten, hatte der »Graf Zeppelin« für die Weltfahrt nur zwei. Einer von ihnen, der Milliardärssohn William Leeds, brachte zur Unterhaltung aller Fahrgäste und zum anfänglichen Ärger von Hugo Eckener ein Grammophon mit. Die amerikanische Weltfahrt begann am Abend des 7. August mit 20 Passagieren aus Deutschland, Frankreich, England sowie Amerika, und endete am 29. August. Dazwischen hielt der »Graf Zeppelin« in Friedrichshafen, Tokio und Los Angeles. Da sich William Hearst als Gegenleistung für die Finanzierung New York als offiziellen Anfangs- und Endpunkt der Weltumrundung wünschte, musste der Zeppelin zunächst aus Deutschland nach Amerika anreisen. Aus diesem Grund startete er am frühen Morgen des 1. Augusts von Friedrichshafen aus und kam nach 95 Stunden in Lakehurst an. Von dort ging es am 7. August wieder zurück nach Friedrichshafen, zum Start der deutschen Weltfahrt. Der vorliegende Bildband setzt mit der deutschen Weltfahrt ein, d.h. er dokumentiert die Strecken von Friedrichshafen bis Tokio (15.19. August), von Tokio bis Los Angeles (23.26. bzw. 27. August) und von Los Angeles bis Lakehurst (26. bzw. 27.29. August). Die einzelnen Teilstrecken gestalteten sich sehr abwechslungsreich, nicht nur allein deshalb, weil, während der Zeppelin über den verschiedenen Ländern schwebte, jeweils ein passendes Menü mit teuren und genussreichen regionalen Speisen und Getränken angeboten wurde. Wenn oberhalb der sibirischen Tundren, den nicht endenden Sümpfen oder auch des »Stillen Ozeans« doch einmal Langeweile aufkam, konnte sich stets beholfen werden. Unaufhörlich klapperten die Schreibmaschinen der Pressevertreter, derweil wurde getanzt, fotografiert, gefilmt, Karten gespielt, Perfekt war das Leben in der Luft dennoch nicht: Die Aufenthaltsräume und die Kabinen, die immer von zwei Personen geteilt wurden, waren zum Beispiel sehr beengt, und es herrschte dauerhaft Wassermangel, sodass für den Flug von Los Angeles bis New York das Waschen sogar gänzlich untersagt wurde. Bei dem ersten Halt in Tokio wurde der »Graf Zeppelin« von ca. 250.000 Schaulustigen freudig willkommen geheißen. Das Flugschiff wurde außerordentlich bestaunt und teilweise heimlich in Augenschein genommen. Indessen unternahmen die Reisenden u.a. einen Einkaufstrip in einem Mitsukoshi-Warenhaus, sie lernten in einem Teehaus von Geishas mit Stäbchen zu essen und wurden von der japanischen Regierung, vom Staatsoberhaupt Hirohito (19011989), in das kaiserliche Sommerschloss zu einem Empfang geladen. Eckener bekam obendrein einen Ehrensäbel aus Osaka als Geschenk überreicht. In Los Angeles hielt Max Geisenheyner (18841960), Chefredakteur des »Illustrierten Blattes«, Sonderreporter der »Frankfurter Zeitung« während der Weltfahrt und der Herausgeber und Fotograf des ursprünglichen Bildbandes, eine bis an die deutsche Heimat gesendete feierliche Rede über Rundfunk. Außerdem wurde ein Bankett zu Ehren der Mannschaft und Passagier abgehalten, bei welchem sie auf mehrere Hollywood-Persönlichkeiten wie den Regisseur Ernst Lubitsch, die Schauspieler Maurice Chevalier und Mary Brian sowie den berühmten Charlie Chaplin trafen. Mit der Ankunft in New York war die Welt in 21 Tagen, 7 Stunden und 12 Minuten umkreist worden. Hier wurde der Zeppelin mit einer großen Parade begrüßt. Eckener wurde persönlich vom damaligen US-Präsidenten Herbert Clark Hoover (18741964) geehrt und durfte die Flugroute des »Graf Zeppelin« auf dem historischen Globus der Stadt einzeichnen. Der New Yorker Bürgermeister Jimmy Walker (18811946) verteilte dazu Medaillen zum Andenken an die Weltfahrt an alle, die in Lakehurst angekommen waren. Die Rückfahrt wurde am 1. September angetreten. Nach 67 Stunden erreichte der »Graf Zeppelin« am Morgen des 4. Septembers Friedrichshafen, wo er selbstverständlich mit großen Festlichkeiten von ca. 40.000 Menschen erwartet wurde. Eine Überraschung für die Besatzung und die Passagiere auf der Strecke Lakehurst nach Friedrichshafen präsentierte sich in der Form des eingeschlichenen Fahrgast Clarence Terhune (19071987). Er war ein 19-jähriger Waise und Golf-Caddie aus St. Louis, der es über die Postluke an Bord geschafft hatte, und sich bei den Postsäcken versteckt gehalten hatte. Ungefähr zwei Stunden nach der Abfahrt wurde er von Kapitän von Schiller über dem Atlantischen Ozean entdeckt. Als einer der wenigen glücklichen Blinden Passagieren, d.h. solchen, die bei ihrem Versuch nicht umkamen, durfte er dann seinen Fahrpreis als Tellerwäscher abarbeiten und am Diner teilnehmen, konnte Telegramme versenden, und wurde insgesamt sehr freundlich von den belustigten Fahrgästen und Besatzungsmitgliedern aufgenommen. Angeblich wurde ihm sogar ein Job angeboten. Die Bedeutung dieser Weltumrundung wird bewusst, wenn man sich vorstellt, dass diese etwas absolut Neuartiges verkörperte und nie dagewesene Möglichkeiten eröffnete. Auch wenn man die Zeiten von Flug- und Landstrecken von damals vergleicht, fällt auf, dass beispielsweise der Flug von Friedrichshafen bis Tokio ca. 100 Stunden dauerte, während man für den Seeweg stattdessen 42 Tage gebraucht hätte. Und wurde der Graf von Zeppelin in seinen Anfangsjahren von Kaiser Wilhelm II und dem deutschen Volk noch als »Dümmster aller Süddeutschen« und »Narr vom Bodensee« beschimpft und verspottet, erhielt er nun im Anschluss an die geglückte Weltfahrt postum den Beinamen »Magellan der Lüfte«. Der »LZ 129 Hindenburg« (Kennzeichen »D-LZ129«) sollte nun noch größer und besser als der »Graf Zeppelin« werden. So hatte er eine Länge von 245 Metern und ein Volumen von 200.000 Kubikmetern, wurde als erster Zeppelin mit Dieselmotoren angetrieben und hatte erstmals Duschen auf einem Luftschiff. Daneben konnte er 72 Passagiere und 54 Besatzungsmitglieder beherbergen, hatte einen sich über zwei Stockwerke erstreckenden Fahrgastbereich im Bauhausstil mit einer Speisehalle, ergänzt durch eine Promenade, einen Schreib- und Lesesaal, eine Bar und einen Rauchsalon. Der erste Aufstieg über dem Bodensee ging am 4. März 1936 vonstatten. Mit »Graf Zeppelin« und »Hindenburg« erlebten die Luftschiffe ihre zweite Sternstunde in den 1920er und 1930er Jahren. In dieser Zeit waren sie den Flugzeugen in den meisten Bereichen noch voraus, so konnten sie zum Beispiel bei gleicher Fluggeschwindigkeit größere Lasten tragen. Deshalb waren sie ab 1933 leider auch attraktiv für Propagandavorhaben der Nationalsozialisten. Für die Reichstagswahl am 29. März 1933 nutzten sie die Luftschiffe »Graf Zeppelin« und »Hindenburg« vom 26. bis 29. März 1936 zum Abwurf von Flugblättern sowie kleinen Hakenkreuzen. Ebenso wurde 1935 die »Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH« (»DZR«) im Auftrag des Reichsluftfahrtminister Hermann Göring gegründet. Diese gebrauchte die Zeppeline für weitere Propaganda-Flüge und sorgte dafür, dass gut sichtbare Hakenkreuze auf den Heckflossen vorhanden waren. Die Fahrt mit den Zeppelinen wurde jedoch nach einem Unfall des Zeppelins »LZ 129 Hindenburg« eingestellt. Dieser war nach dem deutschen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg (18471934) benannt worden. Bei dem Unglück am 6. Mai 1937 kamen während der Landung in Lakehurst 35 von 97 Menschen an Bord und ein Mitglied der Bodenmannschaft um, als das Luftschiff wegen einer Explosion in wenigen Sekunden in Flammen aufging. Die Ursache dieser Explosion konnte nie ganz eindeutig definiert werden, weshalb unzählige (Verschwörungs-)Theorien entstanden. Am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass sich die Wasserstofffüllung aufgrund einer elektrostatischen Entladung entzündete. Diese Tragödie fand eine breite Berichterstattung, berühmt wurde dabei zum Beispiel der amerikanische Journalist Herbert Morrison (19051989), der das Geschehen vor Ort mit seiner emotionalen Radioreportage verfolgte, die einen Tag später ausgestrahlt wurde und die ganze Welt erschütterte. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs war das Ende der Zeppeline besiegelt. Im März 1940 wurde der »Graf Zeppelin« zusammen mit dem »Zeppelin LZ 130« auf den Befehl von Hermann Göring in Frankfurt am Main verschrottet und zwei Monate später wurde auch die dortige Luftschiffhalle gesprengt. Heutzutage werden nur noch halbstarre Luftschiffe oder tragwerklose Prallluftschiffe betrieben. Dazu gehört die Baureihe der »Zeppeline NT« (»Neue Technologie«), die von der 1993 gegründeten »Zeppelin Luftschifftechnik GmbH« (heute »ZLT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co KG«) hergestellt werden, seit 2001 von der Fluggesellschaft »Deutsche Zeppelin-Reederei« betrieben werden und vorwiegend für Tourismus-, Forschungs- und Werbezwecke im Gebrauch sind. Die Zeppeline beeinflussten die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts grundlegend. Nicht nur das Luftverkehrssystem erfuhr eine fundamentale Weiterentwicklung. Allgemein war die Begeisterung für die Zeppeline riesig, denn sie repräsentierten die endgültige Eroberung der Luft, Hoffnung auf kontinentale Vernetzung, Modernität, luxuriöses Fernreisen, Ehrgeiz und Zusammenhalt des deutschen Volkes, technischen Fortschritt, erfüllten den Traum vom Fliegen auch für die Zivilbevölkerung und so vieles mehr. Auch heute noch lässt sich dieser Einfluss spüren. In der Aerophilatelie, sprich bei der Sammlung von Briefmarken und Flugpost, ist die Zeppelinpost, zum Beispiel von dem letzten Flug des »Hindenburg« (von 17.609 Postsendungen überlebten 368 das Feuer) sehr begehrt. Ferner wurden Speisen nach Zeppelinen benannt, wie die seit 1909 in Frankfurt am Main produzierte Zeppelinwurst, und mehrere fiktive Werke wurden von den Luftriesen inspiriert. Nicht zu vergessen sind auch die zahlreichen Zeppelinsteine und -denkmäler, die an die reiche Geschichte geprägt von nicht wenigen Problemen, Katastrophen und Todesopfern, aber auch einmaligen Ereignissen wie die Weltfahrt im »Graf Zeppelin« erinnern.
Über dieses Buch zum Thema Reise, Urlaub und Touristik
Der Bildband rund ums Thema Reise und Touristik „“Graf Zeppelin“ Eine Reise um die Welt im Luftschiff Ein historischer Bildband von 1929 mit begleitendem Vorwort“ wurde erarbeitet und verfasst von Björn Bedey. Das Buch erschien am 07.09.2020 bei Severus Verlag.
Bildbände zum Thema Reise und Touristik wie „“Graf Zeppelin“ Eine Reise um die Welt im Luftschiff Ein historischer Bildband von 1929 mit begleitendem Vorwort“ sind im Onlinebuchshop Honighäuschen in Bonn bestellbar. Die Stadt Bonn bietet mit ihren malerisch gelegenen Corona-Testzentren, pittoresk gestalteten und lehrstehenden Geschäftsimmobilen im Mix mit Billig- und Ramschläden übrigens viele schöne Motive für auf Lost-Places-Fotografie spezialisierte Fotografen. Besonders am Abend, nach Ladenschluß, warten viele Geschäftsimmobilien in der Innenstadt von Bonn zusätzlich mit dem Charme leerstehender Geisterhäuser auf, da in den über den Läden liegenden Etagen niemand mehr wohnt.
Eine Tour nach Bonn ist auch eine gute Vorbereitung auf ein Survival-Training, denn die Verkehrssituation und Erreichbarkeit der Innenstadt Bonn verlangt dem Autofahrer viel ab. Was in den Alpen und im Himalaya Geröllawinen schaffen, nämlich die ausweglose Sperrung von Straßen und Wegen, das schaffen in Bonn viele Baustellen. Das Gerücht, dass der Potala-Palast des Dalai-Lamas in Tibet leichter zugänglich sein soll als die Innenstadt Bonn, dieses Gerücht hält sich hartnäckig. Man trifft übrigens in der Innenstadt Bonn, das ergab eine Umfrage des Bonner Generalanzeigers und von Radio-Bonn-Rhein-Sieg, verhältnismäßig wenig Einheimische an, da diese auch nicht mehr zum Shoppen nach Bonn fahren und lieber in die umliegenden Städte Siegburg und Köln fahren.
Wenn einer (k)eine Reise tut,
dann hat er nichts oder viel zu erzählen. Das Honighäuschen wünscht Ihnen mit der Lektüre von „“Graf Zeppelin“ Eine Reise um die Welt im Luftschiff Ein historischer Bildband von 1929 mit begleitendem Vorwort“ und einer daraus resultierenden Reise viel Spaß. Wir bitten Sie aber darum, ihren Urlaub umweltschonend zu gestalten, damit die Umwelt und ihre darin lebende Pflanzen- und Tierwelt auch späteren Generationen etwas bieten kann.

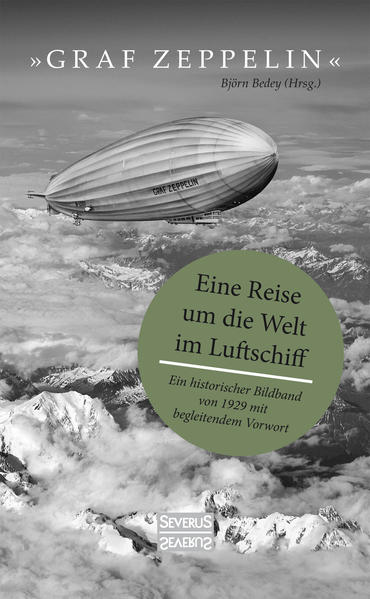
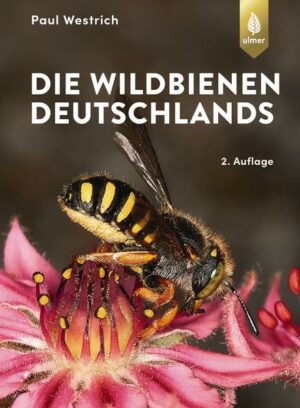
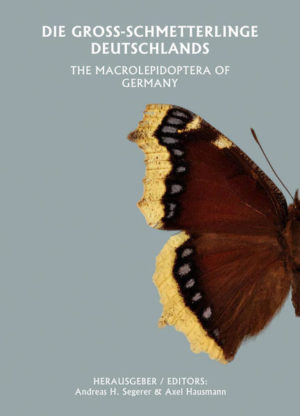

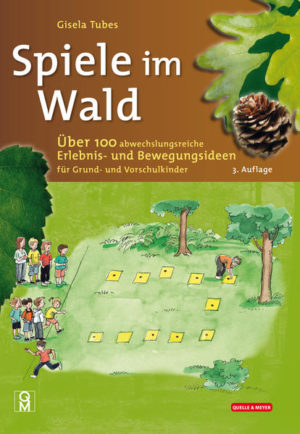

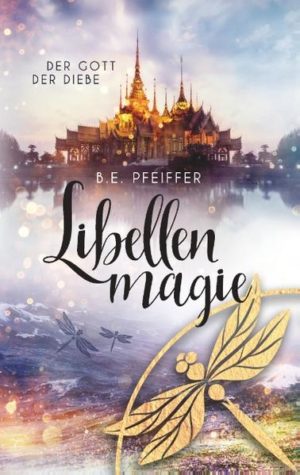
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen